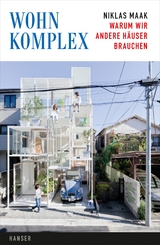Helene, Mutter dreier Kinder, steht eines Tages vom Abendbrottisch auf, geht zum Balkon und stürzt sich in die Tiefe. Ihre Freundin Sarah will den Hinterbliebenen helfen und findet sich unversehens in Helenes Rolle wieder – obwohl sie das nie wollte.
Sarah möchte in dieser Krisensituation helfen – aus der lebenslangen Freundschaft zu Helene heraus, aus Zuneigung zu diesen Kindern, deren ältestes, Lola, sogar einst Teil ihrer Wohngemeinschaft war. Und schließlich, weil man Menschen eben in einer solchen Situation nicht hängen lässt.
Dass damit eine Falle zuschnappt, dass sie ganz selbstverständlich in einer Rolle gelandet ist, die sie weder wollte noch ihr zusteht und die ihr nur aus einem einzigen Grund zugewiesen wird, weil sie eine Frau ist, wird ihr bald klar. Weniger klar allerdings ist ihr der Weg, dort wieder herauszukommen. Aus Tagen werden Wochen, aus Wochen Monate und es droht die Jahresfrist. Begleitet wird in ihrem Geist von einer Manifestation Helenes, die sie spöttisch beobachtet, ihr Fragen stellt, die befreit wirkt.
Helenes hellsichtige Tochter Lola ist nicht bereit, sich den Erwartungen an ihre Rolle zu beugen. Sie liest feministische Literatur, weiß um die Wirkmechanismen des Patriarchats und mit der Intensität jugendlicher Überzeugungen konfrontiert sie Sarah und alle anderen Menschen in ihrer Umgebung mit ihrer Sicht auf die Welt. Klar, überzeugt und analytisch scharf. Doch erst eine Schlüsselsituation, in der sie sich hilflos männlicher Gewalt ausgesetzt sieht, bringt sie zur Tat. Sie ist nicht länger bereit, das Unrecht tatenlos hinzunehmen und die Gewalt männlichen Tätern zu überlassen, die mit ihren Taten unbehelligt ihre Leben weiterleben.
Ein Schlüsselement dafür wird das Teilen von Erfahrungen, von Erlebnissen wie sie nur Frauen (oder als Frauen gelesene Personen) haben – und die sie alle gemacht haben. Daraus speist sich Lolas Wut und es wird eine unglaubliche Energie frei dabei. Das Ende des Schweigens der Frauen wird auch Lola und Sarah helfen, einander zu verstehen und es ist der Motor ihrer Emanzipationsgeschichte. Je weiter diese voranschreitet, desto seltener tritt Helene in Erscheinung.
Mareike Fallwickls Roman hat bei mir massiven Eindruck hinterlassen. Was für eine Kraft, was für eine Wucht steckt in diesem Befreiungsschrei von einem Roman!
Es ist mit Sicherheit eine der aufwühlendsten, beeindruckendsten Lektüreerfahrungen mindestens der letzten Jahre, wenn nicht überhaupt meiner ganzen Lesebiographie. Da sind so viele Aspekte, die mir auch erst jetzt im Nachgang erst klar werden. Ich werde noch lange damit zu tun haben.
Buchdetails:
Mareike Fallwickl: Die Wut, die bleibt. Rowohlt Hundert Augen Hamburg 2022, 377 Seiten, gebunden. ISBN 978-3-498-00296-1, 22 €, als ebook 15,99 €
Bei yourbookshop bestellen und Lieblingsbuchhandlung unterstützen.